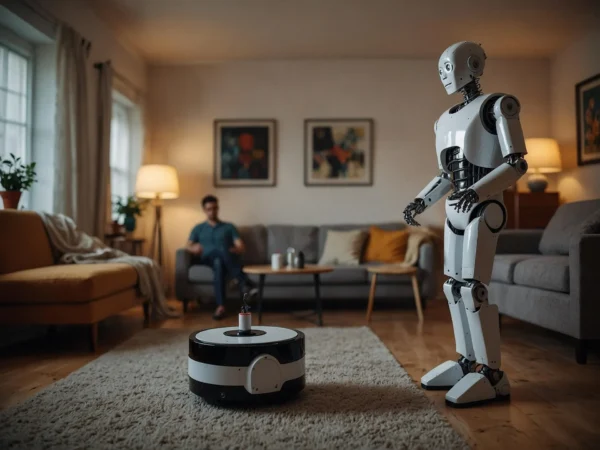Die Schweiz erlebt eine stille Revolution: Statt die Stärke ihres dualen Bildungswegs zu pflegen, drängt die Realität Richtung Studium. Immer mehr Absolventen landen im bequemen Hafen der Verwaltung, wo sichere Löhne, lange Ferien und grosszügige Vorsorge locken.
Zahlen des Bundesamts für Statistik sprechen eine deutliche Sprache: Bis 2033 wird die Zahl der Studierenden an Universitäten und Fachhochschulen um 17 %, an Pädagogischen Hochschulen sogar um 25 % steigen. Schon heute hat die Akademikerquote einen historischen Höchstwert erreicht, von 20,5 % im Jahr 2010 auf über 30 % im Jahr 2020. Unter den 25- bis 34-Jährigen liegt die Schweiz mit 53 % Tertiärabschlüssen weit über Deutschland (33 %).
Diese Dynamik bedeutet: Immer mehr junge Menschen wählen den akademischen Weg, während die Berufslehre, jahrzehntelang das Rückgrat der Schweizer Fachkompetenz, an Attraktivität verliert.
Bildung im Dienste des Marktes
Der Ökonom Mathias Binswanger weist in seinem bemerkenswerten Artikel in der NZZ auf die «Pseudo-Kompetenzen» hin, die unser Bildungssystem zunehmend hervorbringt: oberflächlich erlernte Fähigkeiten, die sich glänzend inszenieren lassen. Mit PowerPoint, Canva oder InDesign Vorlagen entstehen perfekte Folien, visuelle Effekte und souveräne Auftritte, die jedoch inhaltlich oft leer bleiben. Hochschulen überbieten sich im Wettbewerb um Studierende, senken die Anforderungen und prämieren die Verpackung statt den Inhalt. Das Resultat: Akademikerinnen und Akademiker, die jede Idee professionell präsentieren können, aber kaum noch die Werkzeuge beherrschen, um Brücken zu planen und zu bauen, neue Solaranlagen zu entwickeln oder Biodiversität zu sichern.
Das entbehrt sowohl ökonomischer Vernunft als auch ökologischer Sinnhaftigkeit. Während die Wirtschaft händeringend Ingenieurinnen, Techniker und ausgewiesene Fachspezialisten braucht und die Ökologie auf naturverbundene Praktiker sowie versierte Fachpersonen für Umwelt- und Ressourcenschutz angewiesen ist, zieht die Schweiz eine Generation von Verwaltern, Compliance-Spezialisten und Zertifizierern heran.
Die Entwertung der praktischen Intelligenz
Der gesellschaftliche Druck, «unbedingt zu studieren», entwertet das duale Bildungssystem. Dabei sind es gerade die handwerklichen und technischen Berufe, die den ökologischen Wandel konkret vorantreiben: energieeffizientes Bauen, ressourcenschonende Produktion, nachhaltige Landwirtschaft.
Stattdessen treiben wir eine groteske Akademisierung voran.
Was früher ein ehrlicher Beruf war, wird heute in eine künstlich aufgepumpte Titelsprache verpackt. Der Hauswart heisst plötzlich «Facility-Manager», die Kindergärtnerin «Bachelor of Pre-Primary Education». Der Maurer wird zum «Structural Construction Manager», die Metzgerin zur «Fleischveredelungsspezialistin», die Malerin zur «Oberflächenbeschichtungstechnikerin» und der Schreiner zum «Interior-Designer im Holzbereich».
So entstehen Fassaden von Bedeutungen, die zwar nach Diplom klingen, aber nicht nach Handwerk. Hinter dem aufgeblasenen Vokabular geht verloren, dass diese Berufe echte Kompetenzen verkörpern: Nähe zu Material, Werkzeug und Ressourcen, verbunden mit Handfertigkeit, Berufsstolz und Wertigkeit.
Wir leben heute in einer YouTube-Gesellschaft, in der scheinbar alles erlernbar ist – ein Klick, ein Tutorial, ein nachgespielter Handgriff. Doch entscheidend ist nicht das Abschauen, sondern das Anwenden: das konkrete Arbeiten, die Erfahrung der Hand, die Sicherheit im Umgang und das Verständnis für’s Ganze. Erst hier zeigt sich, ob etwas trägt, ob es Bestand hat und ob es wirklich nachhaltig ist.
Genau diese Erdung verliert das Land, und damit auch die Kraft, seine ökologischen Herausforderungen praktisch zu meistern.
Akademiker als Verwaltungselite
Parallel zum Anstieg der Studierenden hat die Schweiz einen markanten Ausbau ihrer öffentlichen Verwaltung erlebt. Zwischen 2011 und 2016 wuchsen die Vollzeitstellen im Bereich «Öffentliche Verwaltung» um knapp 6 %, deutlich stärker als im privaten Sektor (+1,3 %). Noch klarer zeigt sich der Trend finanziell: Von 2008 bis 2022 stiegen die Personalausgaben von Bund, Kantonen und Gemeinden um 34,7 %, während die Bevölkerung nur um 16,4 % zunahm.
Besonders stark wuchs die Verwaltung in den Agglomerationsgemeinden mit +15,6 % Verwaltungsstellen pro Einwohner, während Städte im Schnitt +9,7 % verzeichneten. Basel-Stadt legte sogar um 18,8 % zu. Heute hängen fast 23 % aller Arbeitsplätze in der Schweiz direkt oder indirekt an der öffentlichen Hand.
Viele Absolventen steigen zwar ins Ingenieurwesen oder in die angewandte Technik ein, doch die Einstiegsgehälter sind oft bescheiden: Ingenieure verdienen nach dem Studium im Schnitt rund 78 000 CHF, Bauingenieure 75–85 000 CHF, Architekten etwa 72 000 CHF.
Attraktiver wirkt die öffentliche Verwaltung: Neben besseren Löhnen locken mehr Ferien und grosszügige BVG-Leistungen. Im Kanton Zürich etwa sind es ab dem 21. Altersjahr 25 Ferientage, ab 50 Jahren 27 Tage, ab 60 Jahren 32 Tage. Auch die Gehälter sprechen für sich: Sachbearbeiter verdienen rund 78 900 CHF, wissenschaftliche Mitarbeiter 110 200 CHF, Projektleiter 128 400 CHF. Sicherheit, Karriereplanbarkeit und Vorsorge machen den öffentlichen Sektor zusätzlich attraktiv, weshalb viele Absolventen dorthin statt in die angewandte Technik gehen.
Der Preis: immer mehr hochqualifizierte Kräfte arbeiten an Regulierungen, Zertifikaten oder Berichten – Aufgaben, die wichtig erscheinen, aber wenig zur ökologischen Transformation beitragen.
Arbeitsplätze im Umfeld der öffentlichen Hand
Schätzung für die Schweiz (VZÄ) – Anteil an allen Stellen
Direkt & indirekt durch Staat/staatsnahe Bereiche
Anteil an allen Arbeitsplätzen (VZÄ)
Quelle: Avenir Suisse, «Die Zahl 950’000 – so viele Jobs hängen an der öffentlichen Hand» (≈23 %). Zum Beitrag
Der ökologische blinde Fleck
Weil die Finanzierung an die Studierendenzahlen gekoppelt ist, entstehen systematische Fehlanreize. Plötzlich zählen Diplome mehr als Nachhaltigkeit. So entsteht ein Heer von «Fachmenschen ohne Geist», wie Binswanger sie nennt, die bürokratische Systeme am Laufen halten, während die eigentliche Arbeit in der Pflege, Technik, Landwirtschaft und Energie, längst ausländischen Fachkräften überlassen wird.
Für die Schweiz bedeutet das nichts anderes als eine «Luxemburgisierung» ihres Bildungssystems: Verwaltung des Wohlstands statt Investition in die ökologische Zukunft. Und für das echte Handwerk muss die Migration hinhalten. Wir importieren die Maurer, Schreiner und Pflegekräfte, während die eigenen Absolventen Aktenberge verwalten.
Bildung neu denken
Wenn Bildung weiterhin primär ökonomisch gesteuert wird, wird sie zum Brandbeschleuniger ökologischer Krisen. Wir brauchen eine Rückbesinnung: Wissen vor Schein-Kompetenz, Berufslehre vor Bürokratentitel, ökologische Verantwortung vor ökonomischem Karrierismus.
Denn eine Gesellschaft, die ihre Jugend systematisch in ökonomische Simulationen statt in reale ökonomische & ökologische Fähigkeiten lenkt, betreibt nichts anderes als Zukunftsverschwendung.
⸻
Akademisierung & Verwaltung – auf einen Blick
Datenpunkte aus BFS/OECD, IWP & Avenir Suisse.
Mehr Studium bis 2033
Index 2024 = 100 (Prognose)
Universitäten/FH: +17 %, Pädagogische Hochschulen: +25 % (BFS‑Prognose).
Akademikerquote steigt deutlich
Anteil 25–64 Jahre mit Hochschulabschluss
2010: 20.5 % → 2020: 30.1 %.
Tertiärabschlüsse: Schweiz vs. Deutschland
Anteil 25–34 Jahre mit Tertiärabschluss (2020)
Verwaltung wächst schneller als Privatsektor
Veränderung Vollzeitäquivalente 2011–2016
Öffentliche Verwaltung (NOGA 841) vs. Privatsektor.
Personalausgaben der öffentlichen Hand
Veränderung 2008–2022
Personalausgaben +34.7 % bei +16.4 % Bevölkerungswachstum.
Arbeitsplätze im Umfeld der öffentlichen Hand
Anteil an allen Stellen in der Schweiz
Direkt/indirekt rund 23 % aller Jobs.
Quellen: BFS – Bildung/Studierende · Akademikerquote · BIBB‑Vergleich CH/DE · IWP – Staatswachstum · Avenir Suisse – 950’000 Jobs
Quellen:
• NZZ Binswanger: Einheimische arbeiten in der Verwaltung. Die eigentliche Arbeit wird von Ausländern gemacht», → Link
• Bundesamt für Statistik (BFS), Studierendenprognosen 2023–2033 → Link
• Blick: «Bund erwartet deutlichen Anstieg der Lernenden und Studierenden» (2024) → Artikel
• Wikipedia: «Akademikerquote» (2023) → Artikel
• ResearchGate: «Der Trend zu höheren Bildungsabschlüssen: Deutschland und die Schweiz im Vergleich» (2020) → Studie
• Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP): «Verstädterung und Staatswachstum: Gemeinden unter der Lupe» (2023) → Studie
• Avenir Suisse: «Die Zahl 950 000 – so viele Jobs hängen an der öffentlichen Hand» (2022) → Analyse
• Ferien kt. Zürich: → Link
• Löhne Bundesverwaltung: → Link
• Vollzeitstellen in der Verwaltung → Link