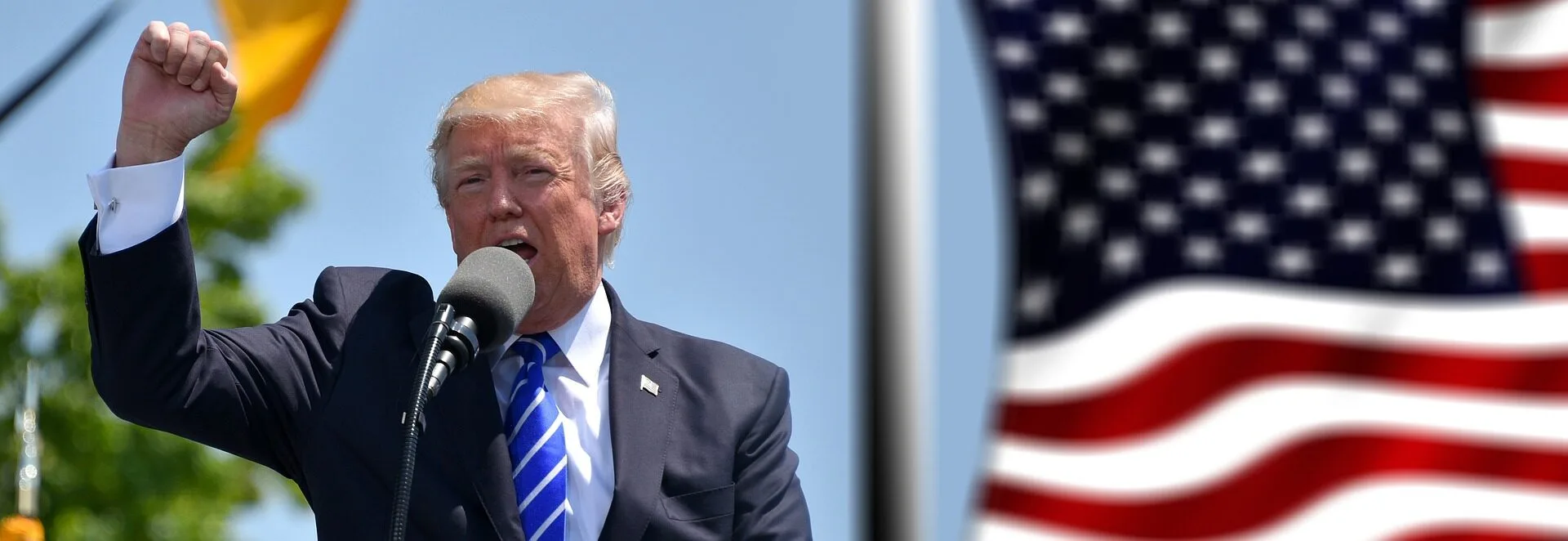Kernbotschaften auf den Punkt gebracht
Die Medienkonferenz des Bundesrates vom 15. Mai 2025 widmete sich einem Thema von zentraler Bedeutung für die Schweiz: der innerstaatlichen Umsetzung der sogenannten Schutzklausel im Freizügigkeitsabkommen mit der Europäischen Union. Diese Klausel soll es der Schweiz ermöglichen, bei gravierenden sozialen oder wirtschaftlichen Auswirkungen der Zuwanderung aus der EU gezielte Gegenmassnahmen zu ergreifen, ohne das bewährte bilaterale Verhältnis zu gefährden.
Bundesrat Jans eröffnete die Konferenz und betonte, dass die Schutzklausel integraler Bestandteil der Weiterentwicklung des bilateralen Wegs sei. Er verwies auf die Notwendigkeit, das Ausländer- und Integrationsgesetz entsprechend anzupassen, um ein rechtlich solides Fundament für die Anwendung der Schutzklausel zu schaffen.
Staatssekretär Vincenzo Mascioli erläuterte in der Folge die konkreten Rahmenbedingungen. Vier zentrale Indikatoren sollen künftig die Grundlage zur Aktivierung der Schutzklausel bilden: die Nettozuwanderung aus der EU, die Zahl der Grenzgängerinnen und Grenzgänger, die nationale Arbeitslosigkeit sowie die Sozialhilfequote. Für jeden dieser Indikatoren werden präzise Schwellenwerte definiert. So könnte etwa ein Anstieg der EU-Nettozuwanderung um mehr als 0,74 % gegenüber dem Vorjahr als Auslöser für die Prüfung der Schutzklausel gelten. Ähnliche Grenzwerte sind für die übrigen Indikatoren vorgesehen, beispielsweise ein Anstieg der Arbeitslosigkeit um über 30 %.
Besonders wichtig: Die Schwellenwerte gelten national. Dennoch können Kantone beim Bundesrat die Aktivierung der Schutzklausel beantragen, auch unabhängig davon, ob Schwellenwerte überschritten wurden. Ziel ist es, auch regionale Besonderheiten, etwa im Tessin, angemessen zu berücksichtigen. Die Schwellenwerte sind nicht mit der EU abgestimmt, sondern ein souveräner Entscheid der Schweiz.
Die Schutzklausel wird jedoch nicht automatisch ausgelöst. Vielmehr wird der Bundesrat im Rahmen eines differenzierten Verfahrens prüfen, ob ernsthafte, durch Zuwanderung verursachte Probleme vorliegen. Ein Automatismus wurde bewusst ausgeschlossen. Vielmehr setzt der Bundesrat auf Flexibilität, um angemessen und verhältnismässig reagieren zu können.
Wird die Klausel aktiviert, kann die Schweiz im gemischten Ausschuss mit der EU Massnahmen beantragen. Kommt es zu keiner Einigung, entscheidet ein Schiedsgericht. Sollte dieses die Massnahmen ablehnen, kann die Schweiz dennoch eigenständig handeln. Die EU kann dann ihrerseits verhältnismässige Ausgleichsmassnahmen beschliessen. Dabei ist jedoch vertraglich verankert, dass die Schweiz nicht automatisch sanktioniert wird, ein Fortschritt gegenüber früheren Regelungen.
In den letzten zwei Jahrzehnten hätten laut Mascioli acht Situationen bestanden, in denen der Bundesrat die Aktivierung der Schutzklausel hätte prüfen müssen. Unter anderem in den Jahren 2002, 2009 oder 2020 aufgrund signifikanter Anstiege der Arbeitslosigkeit.
Die Schutzklausel wird durch ein umfassendes Schutzdispositiv ergänzt. Dazu gehören zum Beispiel Bestimmungen, die verhindern, dass arbeitslose EU-Bürger ein Daueraufenthaltsrecht erlangen, wenn sie nicht aktiv nach einer Stelle suchen. Auch Landesverweisungen für straffällige Ausländer bleiben uneingeschränkt möglich.
Das Instrument der Schutzklausel dient somit als «Feuerlöscher an der Wand», im Idealfall nie gebraucht, aber im Notfall entscheidend. Sie sichert die Handlungsfähigkeit des Staates, ohne das bewährte Verhältnis zur EU zu gefährden. Die Klausel ist zugleich eine Antwort auf Initiativen, die die Personenfreizügigkeit ganz infrage stellen, wie etwa die «10-Millionen-Schweiz» -Initiative. Sie bietet einen Mittelweg zwischen offenen Grenzen und absoluter Abschottung.
Auch wurde das Stromdossier kurz angesprochen. Der Bundesrat informiert über Gespräche mit den USA zur Aufhebung von Zusatzzöllen und kündigt weitere Konsultationen an. In Bezug auf das Freizügigkeitsabkommen laufen die Arbeiten zur Bereinigung und Übersetzung der Texte. Eine Vernehmlassung ist im Frühjahr 2026 vorgesehen.
Insgesamt wurde deutlich: Die Schweiz sucht Eigenverantwortung im europäischen Kontext. Sie will flexibel und souverän auf Herausforderungen reagieren mit Respekt vor der institutionellen Partnerschaft mit der EU, aber auch mit einem klaren Fokus auf die eigene Stabilität und Wohlfahrt.
Fazit ecologie suisse:
Die Schutzklausel ist eine politische Rückversicherung: Sie greift erst, wenn der Schaden bereits eingetreten ist. Das ist systemisch nachvollziehbar, offenbart aber eine grundlegende Schwäche aktueller Politik, denn sie reagiert auf Symptome statt auf Ursachen.
Wer die im Verfassungsauftrag verankerte Wohlfahrt ernst nimmt, sollte sich nicht auf Kriseninstrumente verlassen. Gefordert ist eine vorausschauende Politik, die ökologische, soziale und ökonomische Tragfähigkeit gemeinsam denkt. Nicht erst im Krisenmodus, sondern dauerhaft. Denn Politik, die erst handelt, wenn es weh tut, erzeugt Bewegung, aber selten Balance. Die Konsequenzen solcher Reaktivität tragen nicht wir, sondern die kommenden Generationen.
„Es ist das Schicksal jeder Generation, in einer Welt unter Bedingungen leben zu müssen, die sie nicht selbst geschaffen hat.“
— John F. Kennedy
Quelleangabe: Freie Zusammenfassung basierend auf dem Transkript der Medienkonferenz des Bundesrates zur Schutzklausel vom 15.05.2025. Quelle: admin.ch / Schweizerischer Bundesrat. Das zugrunde liegende Material ist öffentlich zugänglich und gilt gemäss URG Art. 5 als gemeinfrei. Link